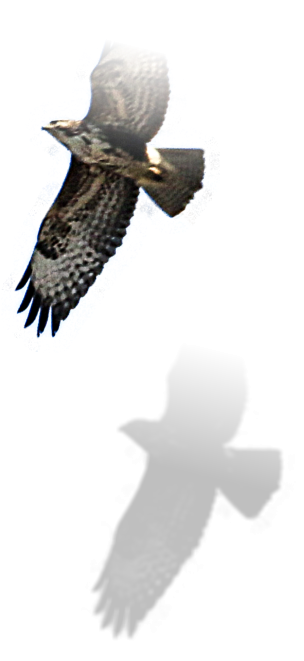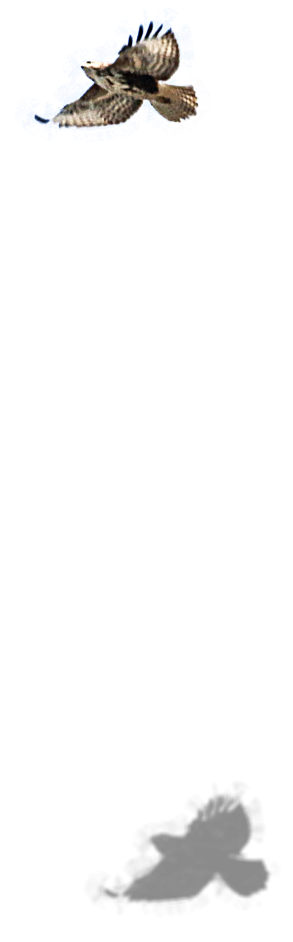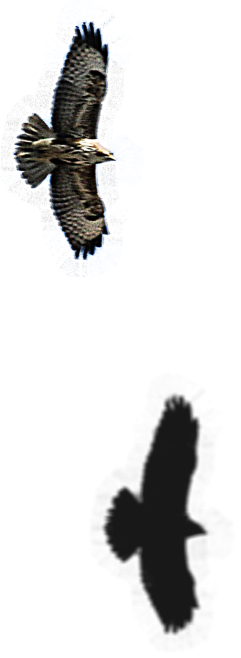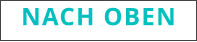

FishME IF YOU CAN
Müssen
wir
wirklich
bereits
über
jede
Reise,
die
wir
tun,
nachdenken?
Müssen
wir
über
jede
Speise,
die
wir
verzehren,
nachdenken?
Müssen
wir
über
jeden
Artikel,
den
wir
kaufen,
nachdenken?
Müssen
wir
über
jeden
Grad, den wir in unserer Wohnung haben, nachdenken?
Alles
darf
und
muss
in
Frage
gestellt
werden
:)
Welchen
Fußabdruck
hinterlasse
ich,
wenn
ich
im
Urlaub
fortfahre.
Verschmutze
ich
die
Luft
und
hinterlasse
den
Nachkommen
nur
Chaos?
Woher
kommt
der
Fisch
auf
meinem
Teller?
Bin
ich
damit
verantwortlich,
dass
Gewässer
zerstört
werden?
Das
Plastik
in
der
Keksdose
ist
am
Ende
gar
aus
China?
Das
geht
ja
gar
nicht!
Darf
ich
im
Winter
zu
Hause
auch
nicht
frieren,
selbst
wenn
ich
noch
mit
einer
Ölheizung
heize?
Oder
werde
ich
dadurch
zum
Ziel
von
radikalen
Linken,
die
sich
vor
allem
für
die
„Allgemeinheit
und
den
Umweltschutz“
einsetzen!
Geschieht
mir
schon
Recht,
wenn
mein
Heizraum
in
die
Luft
fliegt. Isst mein Klopapier auch wirklich zu 64% recycelt?
Leben
wir
in
einer
Zeit,
in
der
man
nichts
mehr
ohne
schlechtes
Gewissen
machen
kann?
Es
sieht
so
aus.
Im
Fadenkreuz
der
wissenschaftlichen
Forschung
stehen
zur
Zeit
Gebirgsseen.
Und
deren
Bewohner,
die
bereits
Verbreitung
im
15.
Jahrhundert
fanden.
So
setzten
Mönche
im
Auftrag
Kaisers
Maximilian
I.
Fische
in
Tiroler
Hochgebirgsseen
aus,
darunter
atlantische
Forellen.
Manche
Nachkommen
dieser
invasiven
Tiere
leben
immer
noch,
etwa
im
Gossenköllesee.
Rund
500
dieser
Forellen
schwimmen
in
dem
auf
rund
2.400
Metern
Höhe
gelegenen
See
in
den
Stubaier
Alpen.
Aber
nicht
nur
vor
langer
Zeit,
auch
heute
werden
noch
Fische
ausgesetzt,
etwa für die Gastronomie oder die Sportfischerei.
Der
am
Projekt
"FishME"
beteiligte
Limnologe
Ruben
Sommaruga
vom
Institut
für
Ökologie
der
Universität
Innsbruck
vermutet,
dass
aus
diesen
Gründen
"unter
anderem
Forellen
in
den
Timmelsjochsee
im
Tiroler
Ötztal
und andere Hochgebirgsseen gelangt sind".
Was
gibt
es
daran
aber
zu
bemängeln?
Ein
solcher
Fischbesatz
kann
laut
Sommaruga
nicht
nur
Auswirkungen,
sondern
sogar
fatale
Auswirkungen
haben.
Die
Fressgewohnheiten
der
eingebrachten
Fische
schaden
den
Ökosys-
temen
im
und
rund
ums
Wasser.
Entwickeln
sich
beispielsweise
weniger
Larven
zu
Mücken,
fehlen
diese
als
Nahrungsquelle
für
Vögel
und
Reptilien.
Aber
auch
für
die
Fische
selbst
sind
die
kargen
Seen
kein
idealer
Lebensraum.
"Sie
sind
arm
an
Nährstoffen
und
wenig
produktiv.
Das
bedeutet,
die
Fischpopulationen
können
sich
nicht
in
einem
gesunden
Maße
ernähren
und
vermehren",
so
Sommaruga.
Französische
Kollegen
fischten
Fische
mit
stark
deformierten
Köpfen
und
überdimensionierten
Augen
aus
Hochgebirgsseen
-
eine
Folge
von
Mangel-
ernährung.
Wenn
man
das
berücksichtigt,
ist
es
wahrlich
erstaunlich,
dass
diese
Fische
bereits
500
Jahre
über-
lebt
haben!
Aber
nicht
alle
Fischarten
sind
gleich
schädlich:
Eine
sticht
dabei
besonders
hervor!
Die
Elritze!
"Elritzen sind die schlimmste Fischart, die in diese Seen eingeschleppt werden", so Sommaruga.
Die
kleinen
Fische
fressen
große
Mengen
an
tierischem
Plankton
wie
Wasserflöhe.
Diese
Kleinstlebewesen
wiederum
ernähren
sich
von
pflanzlichem
Plankton.
Ohne
sie
kann
sich
dieses
stärker
vermehren,
was
zu
Sauer-
stoffmangel
und
hohen
Nährstoffgehalten
in
den
Seen
führen
kann.
Dabei
begünstigen
steigende
Temperaturen
bereits vielerorts das Wachstum von pflanzlichem Plankton.
So idyllisch wie der Schrecksee im Allgäu präsentiert sich
nicht jeder Gebirgssee. Aber was spielt sich unter der
Oberfläche ab? Invasive Tiere fressen das tierische
Plankton!
Fotocredit: pixabay
Gleich
vorweg:
Elritzen
kann
man
sogar
essen!
In
Russland,
so
erfährt
man,
werden
sie
mariniert
und
können
sogar
im
Ganzen
gegessen
werden.
Eine
weitere
Verbreitung
finden
sie
allerdings
als
Köderfische.
Aufgrund
ihrer
Größe.
Die
Elritze,
oder
Phoxinus
phoxinus,
ist
ein
kleiner
Schwarmfisch
und
lebt
in
Gewässern
der
Forellen-,
Äschen-
und
Barbenregion,
aber
auch
in
den
kiesigen
Uferzonen
von
Seen.
Ihre
Nahrung
besteht
aus
boden-
bewohnenden Insekten (-larven), kleinen Muscheln und Kleinkrebsen.
Damit
die
negativen
Folgen
von
Fischbesatz
auf
Ökosysteme
im
Hochgebirge
niedrig
bleiben,
brauche
es
zuerst
Wissen
über
diese
Folgen
und
dann
den
Willen,
die
Fische
zu
entfernen,
betonen
die
Forscher.
"Es
ist
sehr
wichtig,
dass
in
den
Köpfen
der
Menschen
ankommt,
dass
Fische
nicht
in
Hochgebirgsseen
gehören",
betonte
Sommaruga.
"Viele
Menschen
denken,
dass
Fische
in
Hochgebirgsseen
gehören",
betonte
der
Limnologe.
So
sagten
in
einer
im
Rahmen
des
Projekts
durchgeführten
Umfrage
332
Befragte,
Fische
zu
besetzen
sei
eine
gute
Maßnahme,
338
gaben
keine
Antwort,
231
gaben
an,
es
nicht
zu
wissen.
Zudem
gebe
es
in
Österreich
eine
starke
Fischereilobby,
bei
der
man
bisher
auf
taube
Ohren
stoße.
Auch
sie
werden
ihre
wissenschaftlichen
Argumente
für die Fische haben …
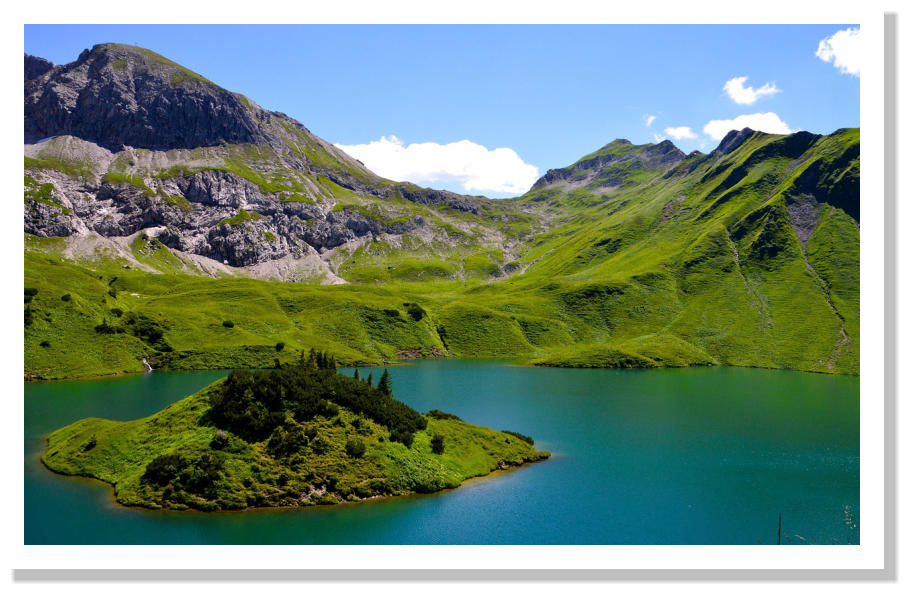

Die Elritze hat echt ein Glück, dass Berliner
Linke noch nicht auf sie aufmerksam geworden
sind. Sie müßten fürchten, gesprengt oder
geschmort zu werden. Ah ja: Mit Limnologen
haben sie aber auch nicht mehr Glück!
Fotocredit: wikipedia