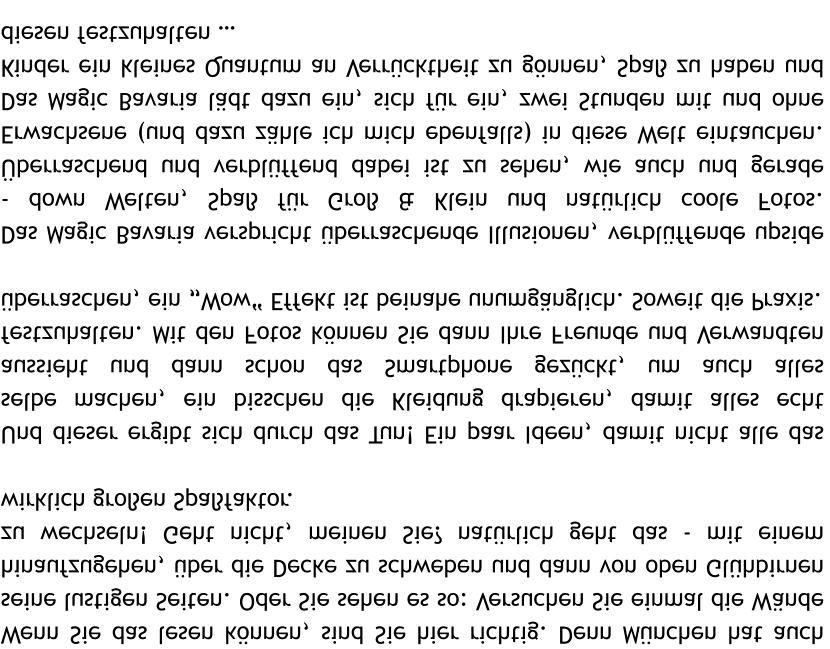AUCH ERWACHSENE KÖNNEN ERZÄHLUNGEN LAUSCHEN!
Es
gibt
manches
immer
wieder
und
einiges
auf`s
Neue
in
einer
Millionenstadt
wie
München
zu
entdecken.
Beispielsweise
eine
Ausstellung
in
der
altehrwürdigen
alten
Pinakothek
.
Das
Gebäude
selbst
-
mit
dem
bescheidenen
Anspruch
bei
der
Errichtung
als
modernster
Museumsbau
des
19.
Jahrhunderts
zu
gelten
-
wurde
1836
eröffnet.
Im
zweiten
Weltkrieg
wurde
er
beschädigt
und
in
den
50er
Jahren
in
veränderter
Form
wieder-
hergestellt.
Die
Basis
der
Sammlung
reicht
natürlich
viel
weiter
zurück:
Sie
beginnt
im
16.
Jahrhundert,
unter
anderem mit der Darstellung von Albrecht Altdorfers berühmter
Alexanderschlacht
.
Aus
der
selben
Zeit,
und
teilweise
auch
früher,
stammen
die
Bilder
einer
Ausstellung,
die
einfach
nur
glänzt.
Um
es
auch
gleich
vorwegzunehmen:
Vergleichbares
habe
ich
in
dieser
Qualität
und
Quantität
nur
in
Italien
gesehen.
Florenz,
Pisa,
Venedig,
Siena.
Was
man
Italien
zugute
hält,
aus
einem
unendlichen
Reservoir
an
Darstellungen
aus
der
Renaissance
mit
Werken
einer
künstlerisch
unglaublichen
Ausdruckskraft
schöpfen
zu
können,
ist
in
Grundzügen
auch
München
gelungen.
Natürlich
nicht
mit
den
italienischen
Meistern,
in
der
alten
Pinakothek
werden
Werke
aus
den
Bereichen
der
Altdeutschen
und
Altniederländischen
sowie
der
Flämischen
Malerei
des
16.
und
frühen
17.
Jahrhunderts
aus
dem
eigenen
Bestand
gezeigt.
Unter
dem
Titel
WIE
BILDER
ERZÄHLEN
werden
die
reichen
Bestände
der
flämischen
Gemälde
des
16.
und
17.
Jahrhunderts
präsentiert,
die
eine
Vielzahl
von
Themen
wiedergeben.
Dadurch
lässt
sich
auch
die
zunehmende
Ausdifferenzierung
der
Gattungen
zwischen
Historie,
Genre
und
Landschaft
nachvollziehen:
Der
„Große
Blumenstrauß“,
aus
der
Werkstatt
von
Jan
Brueghel
d.
Ä.,
über
das
„Schlaraffenland“
hin
zu
„Der
Bethlehemitische
Kindermord“
von
Pieter Brueghel d.J. (nach Pieter Bruegel d. Ä.), 1597.
Hier
möchte
ich
kurz
verweilen.
Ich
habe
in
Italien
Darstellungen
dieses
Themas
gesehen,
die
nur
mit
„grausames
Gemetzel“
beschrieben
werden
können.
Eine
wahre
Orgie
an
Brutalität,
Blut
und
Verzweiflung.
Nicht
so
bei
Breughel.
Ihm
gelingt
es,
die
Eindringlichkeit
der
Situation
durch
ein
Gefühl
von
Beklemmung
hervorzurufen, die ohne ausuferndes Gemetzel auskommt.
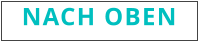





Wie
Bilder
erzählen:
Storytelling
von
Albrecht
Altdorfer
bis
Peter
Paul
Rubens.
Auch
das
„bis“
trägt
Namen:
Bernhard
Strigel,
Hans
Schöpfer
d.
Ä.,
Jan
Sanders
van
Hemessen,
Hans
Wertinger,
Willem
Key,
Hans
Pleydenwurf
oder
Martin
Schaffner.
Mit
diesen
nicht
ganz
geläufigen
Namen
ist
es
gelungen
eine
faszinierende
Ausstellung
zusammenzustellen,
die
zeigt,
wie
die
Künstler
durch
Komposition,
Farbe
und
Detail
Geschichten
in
Bildern
entwickeln
und
zum
Leben
erwecken,
um
dabei
Botschaften
zu
vermittelten.
So
wird
das
Bild
zum
Medium,
das
kulturelle Hintergründe und soziale Aspekte transportiert.
Der
absolute
Höhepunkt
der
Ausstellung
findet
sich
in
den
gezeigten
Altären
vom
Spätmittelalter
bis
zum
Beginn
der
Reformation.
Eine
wichtige
Aufgabe
für
Künstler
und
ihre
Werkstätten
ist
im
späten
Mittelalter
und
der
frühen
Neuzeit
die
Herstellung
von
Altaraufsätzen.
Der
Raum
versammelt
Altarretabel
aus
Deutschland
und
den
Niederlanden
vom
späten
15.
bis
ins
16.
Jahrhundert
in
chronologischer
Abfolge.
Alle
hier
gezeigten
Altäre
konnten
durch
Öffnen
und
Schließen
ihrer
Flügel
ihre
Gestalt
verändern
und
so
zu
verschiedenen
Anlässen
ganz
unterschiedliche
Geschichten
erzählen.
Geschlossen
zeigten
sie
die
Außenseiten
der
Flügel.
Beim
Kaisheimer
Altar
kann
man
dafür
den
geöffneten
und
den
geschlossenen
Zustand
gleichzeitig
erleben:
Schon
1715
wurden
die Tafeln gespalten, um beide Flügelseiten nebeneinander präsentieren zu können.
Die
kleinformatigen
Madonnenbilder
schließen
eine
unglaublich
sehenswerte
Sonderausstellung
ab.
Unter
ihnen
befindet
sich
auch
das
2025
neu
erworbene
Gemälde
„Maria
als
Himmelskönigin“
von
Hans
Baldung
Grien.
Die
Erzählweisen
werden
nochmals
in
den
Mittelpunkt
gerückt,
mit
unterschiedlichsten
Ergebnissen:
Maria
kann
beispielsweise
ebenso
als
entrückte
und
distanzierte
Himmelskönigin
wie
als
liebvolle
Mutter
eines
Säuglings
erscheinen,
beim
Jesuskind
reicht
das
Spektrum
der
Möglichkeiten
entsprechend
der
doppelten
Natur
Christi
vom
ganz irdisch aufgefassten Säugling bis hin zum Weltenherrscher in Kindesgestalt.
Eine
mehr
als
empfehlenswerte
Ausstellung
-
gerade
vor
Weihnachten,
um
dem
„Weihnachtswunder“
und
dem
„Adventzauber“ zu entgehen. Lassen Sie sich einfach etwas erzählen …
.

Auch
bei
Breughel
gibt
es
ein
Gezerre,
ein
Wehklagen,
pure
Verzweiflung.
Mord.
Bildrecht:
Bayerische
Staatsgemäldesammlungen
–
Alte
Pinakothek
München.
Aber
bei
Matteo
di
Giovanni
wird
der
Schmerz
spürbar,
die
Ausweglosigkeit
der
Mütter
bedrückend,
die
ihre Kinder schützen wollen. Und auch die Brutalität der Schlächter …
Coverseite: Joos van Cleve, Marientodaltar, die hll. Christina und Gudula mit Christina uns Sibilla Hackeney, 15 - 1523

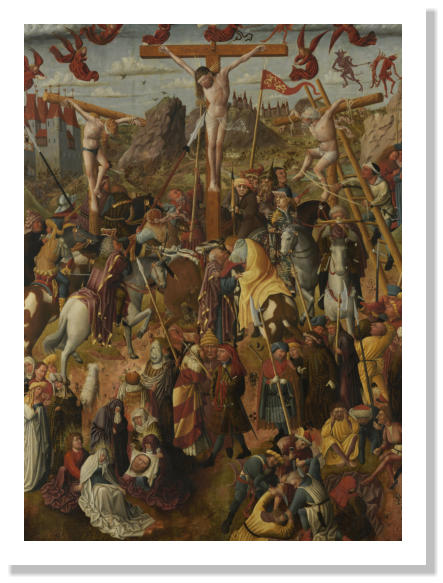
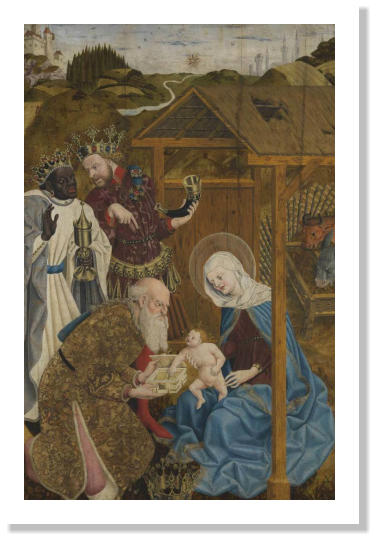
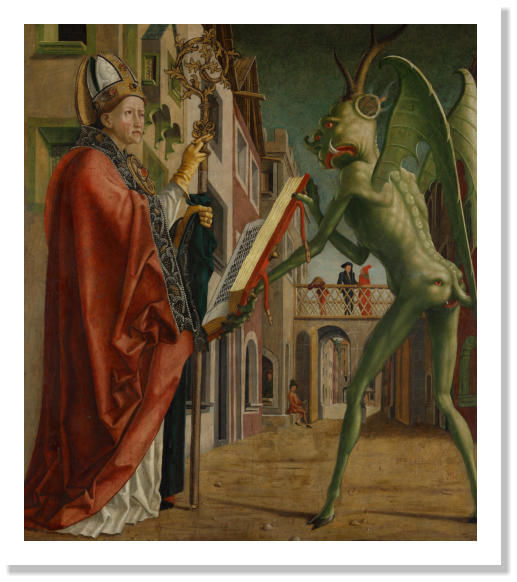
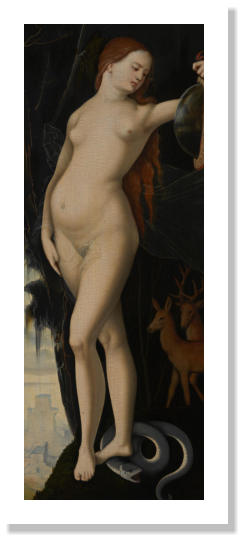

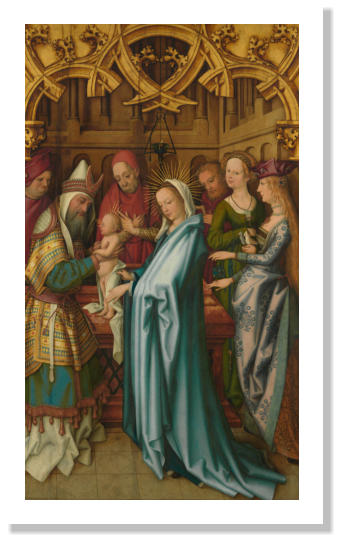
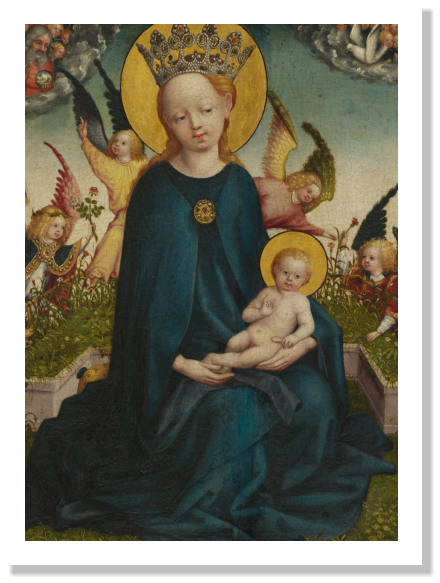
Immer der Reihenfolge nach - von links oben:
Stefan Lochner, Maria mit dem Jesuskind vor der Rasenbank, um 1440
Meister der Benediktbeurer-Kreuzigung, Kreuzigung Christi, um1455
Michael Pacher Kirchenväteraltar, Fluegelaussenseite: Der Teufel weist dem hl. Augustinus das Buch der Laster vor, um 1480
von links unten:
Hans Holbein d. Ä., Kaisheimer Altar. Darbringung im Tempel, 1502
Hans
Baldung
Grien,
Maria
als
Himmelskönigin,
1516
-
1518
daneben:
Hans
Baldung
Grien,
allegorische
Frauengestalt
mit
Spiegel,
Schlange,
Hirsch und Hindin, 1529
Meister der Pollinger Tafeln, Marienaltar, Anbetung der heiligen drei Könige, 1444
Alle Bildrechte: Bayerische Staatsgemäldesammlungen – Alte Pinakothek München
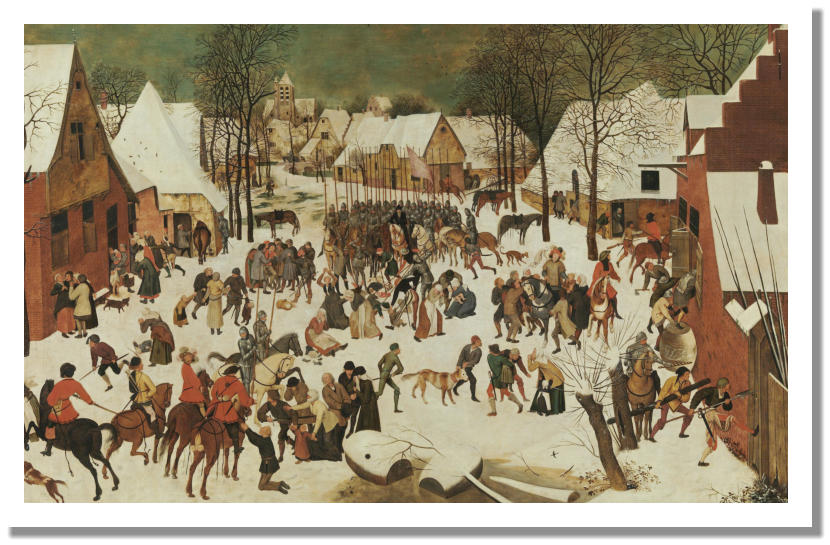
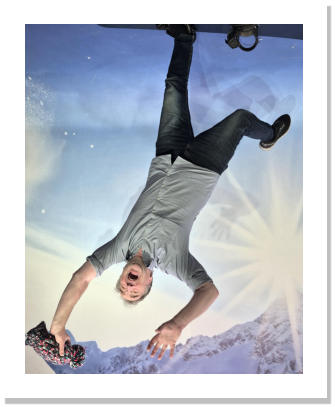

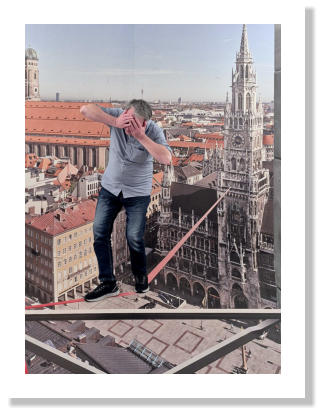

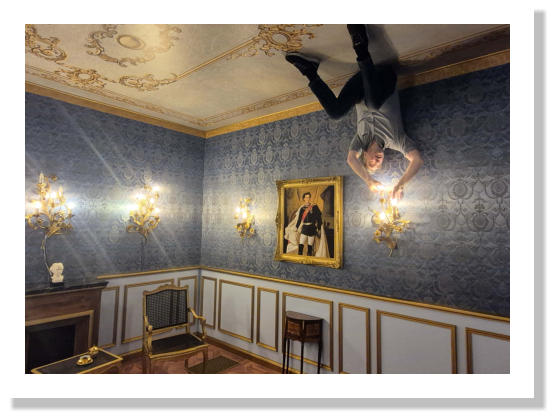
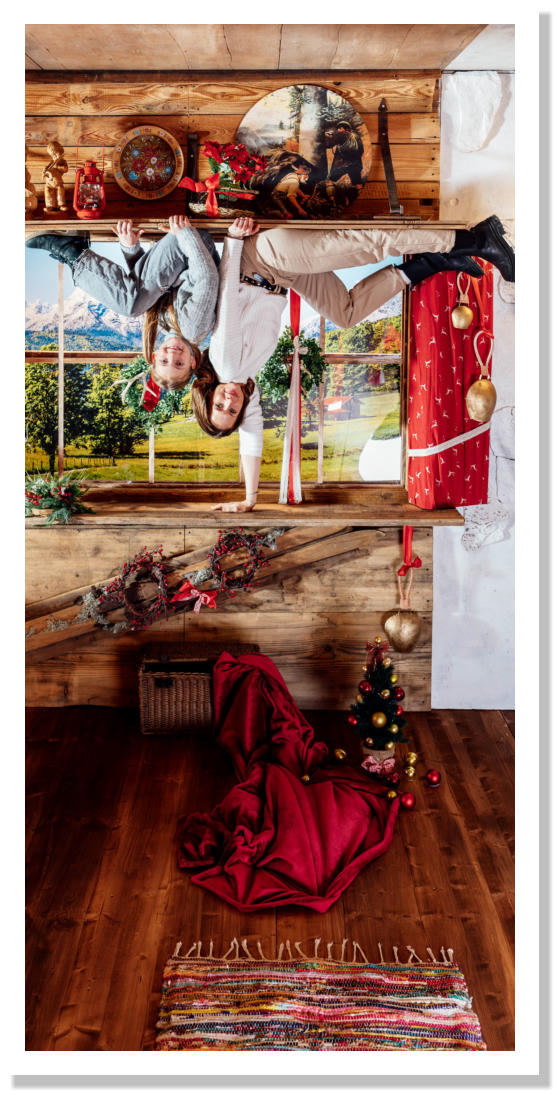
30 interaktive Fotokulissen und Illusionen auf 1.000 m² versprechen eine einmalige und kurzweilige Unterhaltung mit
festgehaltenen Erinnerungen: Sei es beim Glühbirnenwechsel von der Decke aus im Königssaal, tolle Farbspiele mit
Lichteffekten oder ihr wagt Euch auf die Slackline! Da ich Höhenangst habe, halte ich mir dabei lieber die Augen zu!
Daraufhin ist mir gleich bei einem Backflip die Mütze weggeflogen …
Fotocredits: Magic Bavaria Erlebnismuseum, der MÜRZPANTHER